Ruf uns an
+49 551 492 482 82
Lineares Denken folgt verführerisch einfachen Mustern:
Einfache Konzepte beliebt und gleichzeitig kreuzgefährlich: Sie stoßen in einer vernetzten, dynamischen Welt schnell an Grenzen - und oft werden Kosten und Konsequenzen unachtsam externalisiert.
Lineare Problemlösungen betrachten oft nur eine Ebene von Situationen und lassen die Wechselwirkungen und Rückkopplungseffekte unbeachtet.
Ein systemisches Verständnis kann dabei helfen, Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und so mehr Freiheitsgrade zu entwickeln. Dabei werden "Probleme" als Teil eines Netzwerks aus variierenden Faktoren betrachtet, die sich gegenseitig beeinflussen.
Denken in Systemen ermutigt uns, die Beziehungen zwischen Elementen zu erforschen und zu verstehen, wie ein beabsichtigtes Ergebnis durch komplexe Interaktionen beeinträchtigt werden kann.
Der Klassiker: "Kundenzufriedenheit steigert die Weiterempfehlungsrate".
Klicke ein paar mal auf das "Pfeil-nach-oben"-Zeichen bei der Kundenzufriedenheit und schau Dir an, was passiert:
Ok, ist jetzt nicht besonders aufregend: Es ist eine ganz lineare Sache. Leider und zum Glück ist die Welt nicht ganz so einfach, denn ...
Der Klassiker: "Kundenzufriedenheit steigert die Weiterempfehlungsrate".
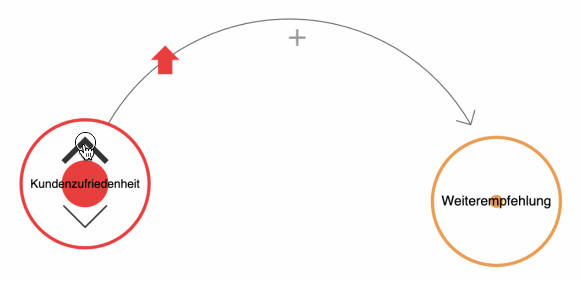
Das ist einfach. Diese Denkweise lässt jedoch Wechselwirkungen komplett aussen vor, denn ...
Der Psychologe und Coach Klaus Eidenschink beschreibt in seiner Serie "Wenn das Gute schlecht ist" auf eine fein differenzierte Weise, wie in funktionalen Gegebenheiten fast ausnahmslos auch dysfunktionale Anteile enthalten sind.
Das gilt auch für die Weiterempfehlung und Kundenzufriedenheit:
Klicke bei Kundenzufriedenheit auf das "Pfeil-nach-oben"-Zeichen und schaue Dir die Wechselwirkung an:
In der Realität sieht es noch etwas dramatischer aus: Schon kleine Fehler und Wartezeiten können die Kundschaft leicht verärgern. Im Modell lässt sich das verdeutlichen, indem wir der Wechselwirkung zwischen Menge der Kundschaft und Kundenzufriedenheit mehr Gewicht geben:
Wow, wer hätte das gedacht: So eine kleine Veränderung - so große Auswirkungen!
Der Psychologe Klaus Eidenschink beschreibt, dass funktionale Gegebenheiten immer auch dysfunktionale Anteile enthalten.
Das gilt auch für die Weiterempfehlung und Kundenzufriedenheit:
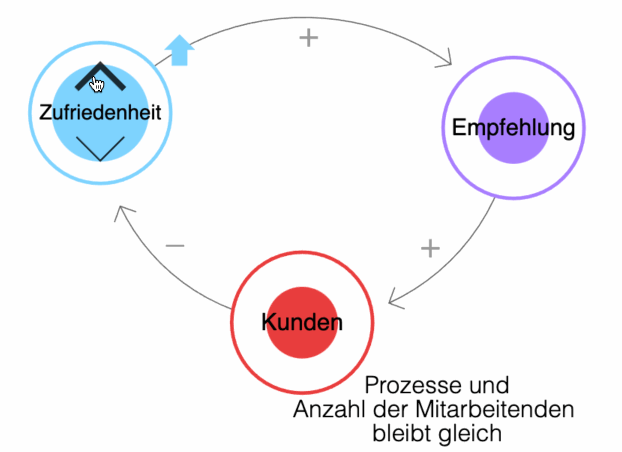
In der Realität sieht es noch dramatischer aus: Schon kleine Fehler und Wartezeiten können Kundschaft leicht verärgern. Im Modell siehst Du, was passiert, wenn die Gewichtung dazu verändert wird:
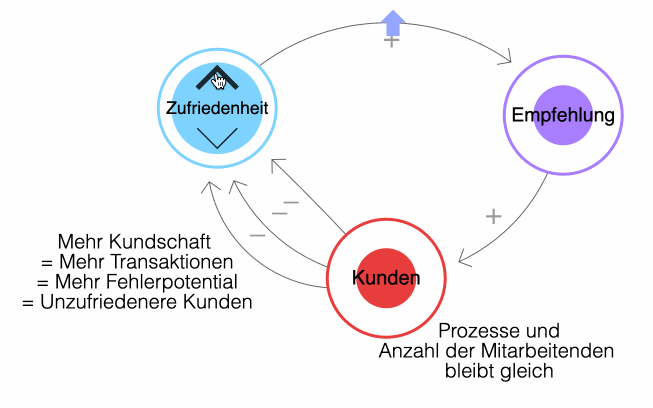
Je mehr System-Komponenten (Stakeholder, Verbindungen, Gewichtungen etc.) berücksichtigt werden, umso interessanter wird es:
Dieses -immer noch sehr einfache- Modell umfasst jetzt
Klicke auf eine Komponente und schau Dir an, was passiert:
Je mehr System-Komponenten (Stakeholder, Verbindungen, Gewichtungen etc.) berücksichtigt werden, umso komplexer werden auch die Wechselwirkungen:
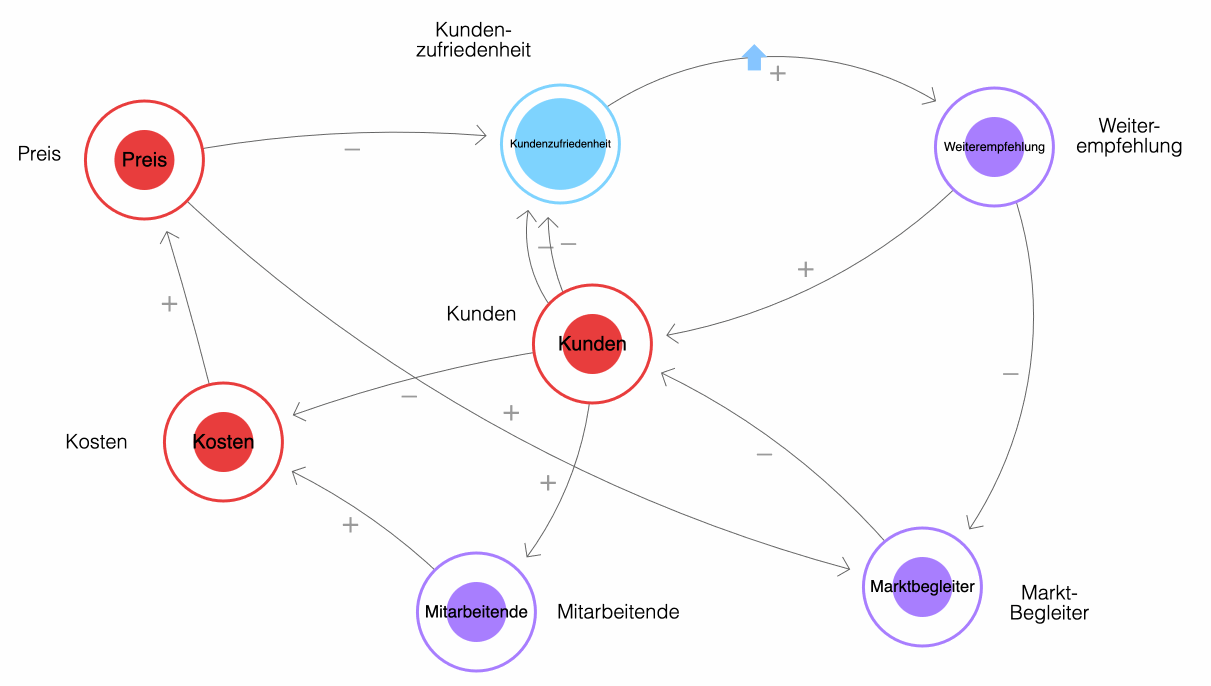
All das hier sind sehr einfache, niedrigkomplexe Modelle. Und gerade daran lässt sich sehen, wie schnell ein Netzwerk aus wenigen Komponenten unvorhersehbar in seinen Auswirkungen wird - vor allem, wenn es um Menschen geht.
In diesem Beispiel kommt eine zweite Schleife dazu - und mit ihr vielleicht auch die Erkenntnis, dass sogar der Erregungspunkt innerhalb eines Netzwerks von hoher Relevanz ist:
Probiere es aus: Klicke zum Start auf den "Pfeil-nach-oben" bei Angst: Ein Umfeld, das auf der Basis von Angst (re-)agiert, bringt selten eine menschenfreundliche Umsetzung in Gange. Schau Dir die Entwicklung und die Auswirkung auf den weiteren Feedback-Prozess an.
Aber Angst ist eben nicht alles. Probier etwas anderes aus:
All das hier sind sehr einfache, niedrigkomplexe Modelle. Und gerade daran lässt sich sehen, wie schnell ein Netzwerk aus wenigen Komponenten unvorhersehbar in seinen Auswirkungen wird - vor allem, wenn es um Menschen geht.
In diesem Beispiel kommt eine zweite Schleife dazu - und mit ihr vielleicht auch die Erkenntnis, dass sogar der Erregungspunkt innerhalb eines Netzwerks von hoher Relevanz ist:
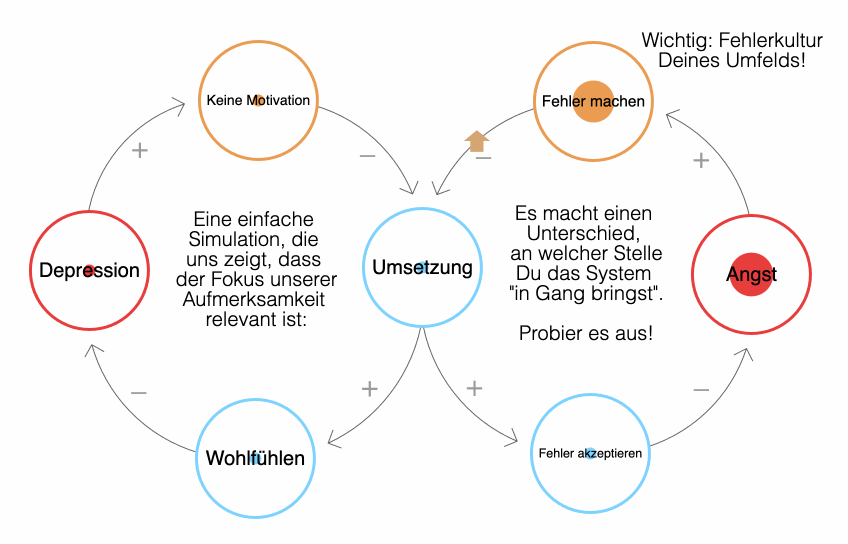
Aber Angst ist eben nicht alles. Wenn der Erregungspunkt nicht auf der Angst liegt, sondern zum Beispiel auf der Akzeptanz von Fehlern, sieht das Beispiel komplett anders aus:
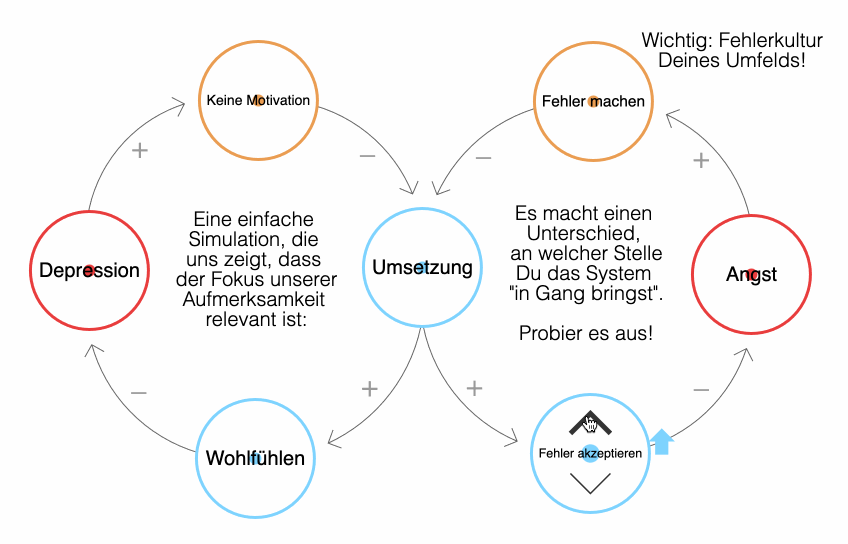
... und gleichzeitig erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für ein gelingendes Leben und Wirksames handeln mit jedem einzelnen Baustein und jeder kleinen Wechselwirkung, die wir besser verstehen.

Wir bei nevo lieben es, komplexe Netzwerken mit vielen verschiedenen Stakeholdern, Aspekten und Interaktionen zu beschreiben - um gemeinsam mit Menschen wie Dir mehr Klarheit und Wirksamkeit entstehen zu lassen!
Hinweis: Der MapsTell Zertifizierungskurs 2025 ist wunderbar dafür geeignet, die eigenen systemischen Überlegungen um die Welt des Verhaltens zu erweitern:
In dieser sehr kleinen Runde erschließen wir uns ein umfassendes Verständnis menschlicher Verhaltensmuster und erleben gemeinsam, wie wir diese Erkenntnisse in unsere systemischen Überlegungen integrieren können.
In unseren Workshops entstehen viele Fragen - an dieser Stelle wollen wir im Lauf der Zeit die interessantesten Fragestellungen der Teilnehmenden und unsere Antworten darauf veröffentlichen:
Indem wir nicht nur auf offensichtliche Symptome blicken, sondern auch auf tieferliegende Dynamiken und Wechselwirkungen, entdecken wir verborgene Strukturen und Muster. Dies erfordert eine ganzheitliche Betrachtung, bei der auch scheinbar irrelevante Elemente in den Fokus rücken. Wir nutzen systemische Fragetechniken, visualisieren Zusammenhänge durch Systemlandkarten und beziehen unterschiedliche Stakeholder-Perspektiven ein. So lässt sich verstehen, wie Entscheidungen in einem Bereich Konsequenzen in einem anderen auslösen. Durch diese Einsicht können wir gezielte Maßnahmen ableiten, um ungünstige Dynamiken zu durchbrechen, Ressourcen besser zu steuern und das gesamte System zu stärken.
Systemisches Denken ermöglicht es, Veränderung nicht isoliert, sondern als Teil eines größeren Beziehungsgeflechts zu betrachten. Anstatt kurzfristige Eingriffe vorzunehmen, analysieren wir, wie neue Prozesse und Verhaltensweisen mit bestehenden Normen, Werten und Strukturen interagieren. Mit dieser Perspektive integrieren wir Veränderungen schrittweise, beachten Rückkopplungen und evaluieren kontinuierlich ihre Wirkung. Dadurch schaffen wir Bedingungen, in denen langfristige Anpassungen verankert werden, ohne Widerstände unnötig zu verstärken. So entsteht ein stabiles Fundament, auf dem sich nachhaltige Lösungen entfalten können. Unterm Strich geht es um umsichtige, angemessen schnelle Iterationen und eine sorgsame Integration der Feedback-Schleifen in die nächsten Schritte.
Wer sich auf das systemische Denken einlässt, stellt recht schnell fest, dass keine Entscheidung isoliert steht. Wer erkennt, dass jede Handlung weit über den eigenen Einflussbereich hinauswirkt, übernimmt oft auch eine tiefgreifendere Verantwortung. Indem wir verstehen, dass selbst kleine Impulse ein Netzwerk von Rückkopplungen und Nebenwirkungen erzeugen, verhalten wir uns bewusster. Verantwortung umfasst dann nicht nur kurzfristigen Erfolg, sondern auch langfristige Stabilität, soziale Gerechtigkeit und ökologische Auswirkungen. So führt systemisches Denken zu einer integralen Form des Verantwortungsbewusstseins, in der wir die Tragweite unserer Entscheidungen ernsthaft berücksichtigen und umsichtiger handeln.
Systemisches Denken hinterfragt die gewohnten Problemdefinitionen und lenkt den Blick hinter die offensichtlichen Symptome. Oft sind scheinbare Schwierigkeiten lediglich Ausdruck tieferliegender Muster. Durch eine systemische Analyse erweitern wir unser Verständnis von "Problem" hin zu "Potenzial für Anpassung und Wachstum". Statt einzelne Symptome zu bekämpfen, entschlüsseln wir die zugrunde liegenden Strukturen und erkennen, welche Faktoren die Situation aufrechterhalten. Diese neu gewonnene Klarheit befähigt uns, grundlegende Hebel für Veränderung zu identifizieren. Das Ergebnis sind Strategien, die nicht nur oberflächliche Effekte erzielen, sondern langfristig Stabilität, Leistungsfähigkeit und sinnstiftende Entwicklungen fördern.
In eigener Sache: Der MapsTell Zertifizierungskurs 2025 ist wunderbar dafür geeignet, die eigenen systemischen Überlegungen um die Welt des Verhaltens zu erweitern:
In einer angenehm kleinen Runde erschließen wir uns ein umfassendes Verständnis menschlicher Verhaltensmuster und erleben gemeinsam, wie wir diese Erkenntnisse in unsere systemischen Überlegungen integrieren können. Vielleicht bist Du ja dabei?
+49 551 492 482 82
info@nevoteam.de
Online-Termin